Einfluss von Entspannungsverfahren auf die Gene
Es gibt mehr und mehr Grund zu der Annahme, dass wir mit unseren Genen viel flexibler sind als bislang angenommen. Es stimmt, unsere Blutgruppen und Augenfarbe sind genetisch fixiert und begleiten uns ein Leben lang (Ausnahmen bestätigen die Regel). Aber was für Blutgruppe und Augenfarbe gilt, das muss nicht auch zwangsläufig für den Rest der Gene gelten.
Gene sind flexibel; sie lassen sich ein und ausschalten und in ihren Aktivitäten modifizieren. Die Ansicht, dass wir genetisch in Stein gemeißelt sind, ist so modern wie die Annahme, dass die Erde eine Pizza sei.Im Benson-Henry Institut, das dem Massachusetts General Hospital angeschlossen ist, gibt es eine Disziplin, die sich „Mind Body Medicine“ nennt. Man könnte dies mit „Geist Körper Medizin“ übersetzen. Auf jeden Fall scheinen wir hier schon weit weg zu sein von der allseits beliebten evidenzbasierten Schulmedizin.
In diesem Institut ist man seit geraumer Zeit der Frage nachgegangen, welche Mechanismen hinter den Effekten der „meditativen Disziplinen“ stehen, speziell auf eine Entspannung, die man durch Meditation, Autogenes Training etc. ja erreichen möchte und auch kann. Oder handelt es sich hier doch nur um „Einbildung“?
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Laut Angaben von Dr. Benson, dem Institutsleiter, ist Entspannung ein „physischer Status einer tiefen Ruhe, die die physischen und emotionalen Reaktionen auf Stress verändert“, was sich äußert in zum Beispiel einer Herabsetzung von Herzfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz und Muskelspannung. Die nach Außen messbaren „Symptome“ dieser Entspannungsreaktion sind:
- Verlangsamung des Stoffwechsels
- Das Herz schlägt langsam und die Muskulatur entspannt
- Die Atmung ist kräftig aber langsam
- Der Blutdruck ist im unteren Normbereich
- Die Konzentrationen von Stickstoffmonoxid sind erhöht
Eine Studie von Mai 2013 (Relaxation Response Induces Temporal Transcriptome Changes in Energy Metabolism, Insulin Secretion and Inflammatory Pathways) setzte diese Arbeit fort und versuchte die grundlegenden molekularen Mechanismen zu klären, die zu den zuvor gesehenen Reaktionen geführt hatten.
Diesmal wollten die Forscher wissen, ob sich ein Kurzzeiteffekt nach der Entspannungsübung einstellt. Dazu nahmen sie Probanden, die schon über Jahre Entspannungsübungen regelmäßig durchführten. Eine weitere Gruppe von Teilnehmern rekrutierte sich aus Anfängern, die vor und nach 8 Wochen Entspannungstraining untersucht wurden.
Bei jedem Messtag wurde Blut vor, unmittelbar nach und 15 Minuten nach der Entspannungsübung abgenommen und ausgewertet. In diesem Fall bestand die „Entspannungsübung“ ausschließlich im Hören einer CD mit Entspannungsübungen oder entspannungsförderndem Inhalt.Somit schließen die Autoren, dass zum ersten Mal nachgewiesen werden konnte, dass eine Entspannungsreaktion (offensichtlich gleichgültig, durch welche Übung herbeigeführt), besonders nach längerer Übungspraxis, einen elementar positiven Einfluss auf das physiologische Geschehen im Organismus hat.
Die Energieproduktion der Mitochondrien wird erhöht, die Energienutzung wird verbessert, was zu einer Stärkung der Mitochondrien führt. Die Autoren vermuten, dass die Stärkung und Funktionsverbesserung der Mitochondrien teilweise auch auf die Abnahme der Entzündungsbereitschaft zurückzuführen ist.
Meditation experience is associated with increased cortical thickness von Lazar et al. zeigte eine starke Verknüpfung von Dicke der Hirnrinde und Meditation.
Teilnehmer mit einer langjährigen und intensiven Erfahrung mit Meditation zeigten in den Hirngegenden, die mit Aufmerksamkeit, Interozeption und der Verarbeitung von Sinneseindrücken verbunden sind, einen deutlich dickeren Aufbau als bei vergleichbaren Probanden ohne Erfahrung im Meditieren.
Ältere Probanden mit Meditationserfahrung hatten ebenfalls eine dickere frontale Hirnrinde als nicht Meditierende, was die Autoren als eine Möglichkeit interpretierten, dass Meditation eine altersbedingte Abnahme der Hirnrinde verhindert. Damit scheint Meditation die Plastizität des Gehirns positiv zu beeinflussen.
Die Erfahrungen mit der Entspannungsreaktion scheinen darüber hinaus auch Effekte auf das Gehirn und seine Formbarkeit zu haben. Dies bezieht sich auf die Ausbildung von neuen Verbindungen von Neuronen zu Neuronen, besonders bei Stresssituationen. Diese Veränderungen finden auf der Basis einer internen „Rekalibrierung“ des Nervensystems statt – ohne Manipulation des gegebenen Zustandes, was bedeutet, dass Art und Stärke des Stresses gleich hoch sind.
Das Ergebnis zeigte, dass sowohl Kurz- als auch Langzeitübende signifikante Veränderungen der genetischen Ausprägung aufzuweisen hatten. Die Veränderungen bei den Langzeitübenden war deutlich ausgeprägter als bei den Kurzzeitübenden. Die Entspannungsreaktion zeigte, dass sie verbunden war mit einer Erhöhung der Aktivität der Gene, die in Verbindung stehen mit Energiestoffwechsel, Funktion der Mitochondrien, Insulinsekretion und Handling von Telomeren.
Die Aktivitäten von Genen, die mit Entzündungsprozessen und Stressbewältigung assoziiert sind, zeigten sich als deutlich weniger aktiv. Nach Auswertung aller Daten sahen die Autoren, dass die ATP-Synthase in den Mitochondrien und Insulin signifikant erhöht waren. Die Genaktivitäten für NF-kB (ein Transkriptionsfaktor, der für die Auslösung von Entzündung wichtig ist), waren dagegen nur schwach ausgeprägt.
Eine „genetische Studie“ (Genomic Counter-Stress Changes Induced by the Relaxation Response), die im Institut an gesunden Probanden durchgeführt wurde, zeigte dazu bemerkenswerte Ergebnisse. Denn die Probanden, die Entspannungsübungen regelmäßig durchführten, zeigten eine Entspannungsreaktion, die die Aktivitäten von bestimmten Genen verändert hatte.
Dies galt für Lang- und Kurzzeitübende gleichermaßen. Hier war dann auch eine signifikante Veränderung des zellulären Stoffwechsels, der oxidativen Phosphorylierung, der Erzeugung von freien Radikalen und der Reaktion auf oxidativen Stress zu sehen. Daher schlossen die Autoren, dass ein tägliches Üben dieser Entspannungstechniken einen Schutz vor Zellschädigungen darstellt, der sich besonders bei chronischem Stress nicht vermeiden lässt.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Dieser Beitrag wurde am 28.4.2019 erstellt.
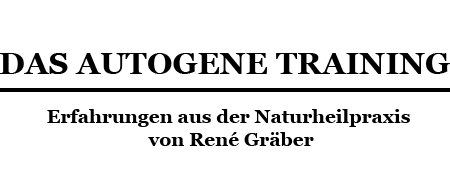


Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!